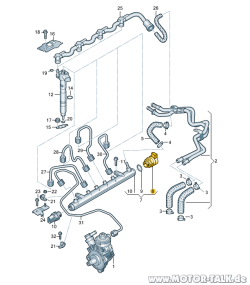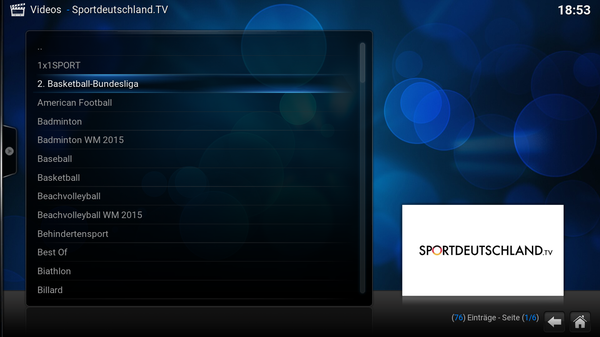„Hauptsache, es ist gesund“: diesen Satz hören junge Eltern oft. Besonders oft bekommen sie diesen Satz zu hören, wenn der frisch auf die Welt gebrachte Nachwuchs irgendwie nicht den Erwartungen des*der Sprecher*in entspricht; das gilt bis heute leider ganz besonders, wenn die Eltern das Verbrechen begingen, ein „Mädchen“ zu zeugen und keinen „Jungen“. Es ist ein demonstratives „aber ist ja auch egal“, was damit aber letztlich genau eines zum Ausdruck bringt: dass es eben nicht egal ist. Die Enttäuschung wird lediglich demonstrativ zur Seite geschoben, der*die Sprecher*in versichert sich selbst der eigenen charakterlichen Überlegenheit, so richtig nett ist der Satz also eh nicht. Aber was bedeutet das eigentlich überhaupt: gesund?
Es gibt wohl kaum einen Begriff, der so flächendeckend unreflektiert bleibt wie jener der „Gesundheit“. Das gilt auch und insbesondere für die Medizin: selbst Ärzte haben oftmals eine eher nebulöse und im Kern sehr essentialistische Vorstellung davon, was gesund ist und was nicht. Wir alle stellen uns etwas anderes darunter vor, glauben aber natürlich daran, alle dasselbe zu meinen. Gesundheit ist eine dieser tückischen „ist doch klar“-Vokabeln, die erst bei näherem Blick zeigen, dass sie eben alles andere als klar sind. Besonders gefährlich wird es, wenn einem solchen schein-klaren, de facto aber hochgradig subjektiven und schwammigen Begriff ein intrinsischer Wert zugeordnet wird, denn von da ist es nicht mehr weit zu gesellschaftlichen Normen und Sanktionen.
Das Problem mit einem essentialistischen Gesundheitsbegriff ist, dass im Hintergrund der Gedanke des „perfekt gesunden“ Menschen steht, und damit letztlich: des perfekten Menschen. Essentialismus impliziert immer eine fiktive, idealisierte Norm, der es besonders nahe zu kommen gilt. In dieser Denkweise lässt sich quasi der Abstand des Individuums zur idealen Gesundheit ausmessen und optimieren. Und genau das passiert in unserer modernen individualisierten Gesellschaft; „Selbstoptimierung“ ist ein ungebrochener Trend.
In einer Welt, in der einerseits die große individuelle Freiheit versprochen und andererseits jede gesellschaftliche Solidarität als Kostenfaktor und wirtschaftliches Hemmnis immer weiter reduziert wird, wird das Individuum auf maximale wirtschaftliche Ausbeutungsfähigkeit getrimmt. Und das Perfide dabei ist: wir merken es nicht einmal. „Schlechtes“ Verhalten wird sanktioniert, „gutes“ Verhalten belohnt. Menschen, denen wir Jahre nicht begegnet sind, kommentieren als erstes das Körpergewicht oder die Fitness. Diese pseudobetroffenen Sätze wie „Du weißt aber, dass Rauchen ungesund ist, oder?“ oder „Hast du etwa abgenommen? Steht dir!“ kennen wir alle und sagen sie oft genug selbst.
Und die verdammten Krankenkassen, denen heutzutage qua Gesetz die wirtschaftliche Optimierung ihrer Versicherten auferlegt ist, bezahlen neuerdings sogar schon elektronische „Fitness-Tracker“ – natürlich nur, wenn der*die Versicherte einwilligt, das eigene Trainingsverhalten von ihnen überwachen zu lassen. Und wer das Spiel nicht spielen will, wer also nicht das maximal Menschenmögliche tut, die eigene Leistungsfähigkeit und „Gesundheit“ zu optimieren und zu erhalten, wird schrittweise zum asozialen Paria erklärt.
Die Pseudowissenschaftlichkeit vieler heutiger Vorstellungen zu Gesundheit lässt sich vielleicht ganz gut an der Geschichte des Body Mass Index (BMI) erläutern. Im 19. Jahrhundert von einem belgischen Statistiker erfunden, sollte die Größe nie mehr leisten, als den statistischen Vergleich des relativen Ernährungsstands von Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen. Die Gesundheit des Individuums damit zu bewerten, davon riet Adolphe Quetelet sogar ganz explizit ab.
Im ausgehenden zwanzigsten Jahrhundert wurde dann von der amerikanischen nationalen Gesundheitsbehörde (NIH) die statistische BMI-Verteilung der Bevölkerung ermittelt und alles außerhalb der sogenannten Standardabweichung für „krank“ erklärt. Nach dieser Definition wurde also letztlich statistisch festgelegt, dass ca. 15% der Bevölkerung „zu dünn“ und weitere 15% „zu dick“ seien. Die daraus erwachsene BMI-Grenze für Übergewicht von knapp unter 27 wurde später zur heutigen Grenze von 25 abgesenkt, so dass quasi über Nacht plötzlich fast 4 von 10 Amerikanern „übergewichtig“ waren.
Schon in den 80ern lag der amerikanische Durchschnitt(!) des BMI bereits bei knapp 24, also dicht unter der heutigen Übergewichtsgrenze. Seitdem hat der BMI des „Durchschnittsamerikaners“ um etwa einen Punkt zugenommen: bei einer Körpergröße von 1,75m entspricht das 75kg anstelle 72kg. Keine große Sache, sollte mensch meinen? Doch: denn diese kleine Verschiebung bedeutet, dass statistisch nun mehr als jeder zweite Amerikaner „Übergewicht“ hat. Und in Europa sieht es insgesamt sehr ähnlich aus; die Zeitungen schreiben deshalb regelmäßig von einer „Epidemie“ der Fettleibigkeit.
Auch mit den angeblich so signifikanten Risiken mit Blick auf Herzinfarkt oder Diabetes sieht es eher mau aus, denn die meisten Untersuchungen genügen nicht einmal grundlegenden Anforderungen an Auswahl von Kohorte und Kontrollgruppe, an Verblindung oder statistische Auswertung. Was de facto bleibt, ist die Bestrafung zigtausender Menschen durch Gesellschaft, Medizin und Politik dafür, dass sie von einem fiktiven Idealbild abweichen.
Der Glaube an den „perfekten“ Menschen entspringt einem zutiefst menschlichen Bedürfnis: nämlich dem nach Zugehörigkeit. Wir sind soziale Lebewesen: Nichtbeachtung durch einen geliebten Menschen ist Qual, Einsamkeit ist Folter. In einer Gesellschaft, in der Großfamilie und Dorfgemeinschaft ihre Bedeutung verloren haben und in der das Leben immer hektischer und schneller zu verlaufen scheint, äußert sich unser Wunsch nach Zugehörigkeit und Geborgenheit in einem Bestreben nach Gleichheit.
Wir Menschen müssen also instinktiv wissen, wer „wir“ sind: wer unsere Gruppe ist, unser Stamm. Und wer nicht zu diesem Wir gehört, gehört zum „Die“. Die, das sind die anderen. Fremde. Egal ob im Nationalismus oder in der Religion, ob bei Sexismus oder Queerfeindlichkeit: stets steht im Raum das Bedürfnis, sich gegen „die“ abzugrenzen. Menschen haben ein Problem mit Vielfalt, mit Andersartigkeit. Anders zu sein, das ist beinahe per Definition schlechter oder gar gefährlich.
So ist es nicht weiter verwunderlich, dass in der Vergangenheit westliche Wissenschaftler versucht haben, zu beweisen, dass andere menschliche „Rassen“ eine geringere Intelligenz besäßen. Und es überrascht auch nicht wirklich, dass Homosexualität bis weit ins zwanzigste Jahrhundert hinein als „Krankheit“ galt, und dass bis heute Sexualkundler versuchen, transidente Menschen als Opfer eines gestörten Sexualtriebs zu pathologisieren.
Gesundheit bzw. Medizin und Biologie, also die Hauptwissenschaften zu ihrer Herstellung und Bewahrung, hatten immer ein eigentümlich intimes Verhältnis zu Ausgrenzung. Egal aufgrund welchen äußeren Merkmals Menschen ausgegrenzt werden: beinahe stets wird sich eine „medizinische“ oder „biologische“ Veröffentlichung finden, die diese Ausgrenzung im Namen der Wissenschaft untermauert.
In Verbindung mit jener fatalen Illusion einer Unparteilichkeit der Wissenschaften (als ob Wissenschaftler nicht durch die Gesellschaft geprägt würden) wird Andersartigkeit weiterhin gnadenlos bestraft. Zeitungen erklären Geflüchtete zu angeblich massenvergewaltigenden Monstern mit mittelalterlichen Ansichten, und Frauen mit Kopftuch schmarotzen angeblich alle Sozialhilfe vom Staat und kriegen zudem dutzende Kinder, die sich dann ein paar Jahre später dem islamistischen Djihad anschließen.
Große Hilfsorganisationen unterstützen „Therapien“, in denen autistischen Kindern „normales“ Sozialverhalten andressiert werden soll. Psychologen und Sexualkundler versuchen derweil, transidente Kinder zu „reparieren“. Immer natürlich, damit diese es „leichter“ haben in der Gesellschaft; denn da jene ja per Definition weiterhin „normal“ ist, kann ihr ultimativ kein Vorwurf gemacht werden, wenn die „unnormalen“ Menschen keinen Platz in ihr haben.
Wenn ich eine Diagnose stellen sollte, dann wäre aber nicht das Individuum mit Autismus oder Kleinwüchsigkeit oder Transidentität „krank“, sondern die Gesellschaft. Es fehlt uns an Empathie, an Mitgefühl. Und damit meine ich ausdrücklich nicht „Mitleid“, dieses schreckliche Konzept der abrahamitischen Religionen: ich meine die Bereitschaft, sich regelmäßig in die Lage anderer Menschen zu versetzen.
Mitgefühl ist natürlich anstrengend. Es ist unbequem. Durch die Augen anderer Menschen zu sehen, kann auch sehr unangenehm sein, wenn das Ergebnis die Erkenntnis bedeutet, dass eigenes Verhalten (direkt oder indirekt) andere verletzt hat. Es ist also vielleicht allzu „menschlich“, die psychischen Rolladen herunter zu lassen und Probleme der „anderen“ einfach auszublenden.
Aber nur wenn wir anerkennen, dass Vielfalt die eigentliche „Norm“ ist, kann es ernste und dauerhafte Verbesserung geben. Und das hätte Konsequenzen: für Schule und Arbeitswelt, für die gesamte Gesellschaft. Und wenn wir von der selbstverantwortlichen Optimierung des Individuums auf maximale Arbeitskraft abrücken, stellt sich notwendigerweise auch die Frage nach unserem Wirtschaftssystem und danach, ob unsere aktuelle Inkarnation des Kapitalismus und die heilige Kuh des fortwährenden, ewigen Wachstums weiterhin unsere gebetsmühlenartig wiederholten Antworten auf alles bleiben können. Ich finde ja, es wird höchste Zeit.